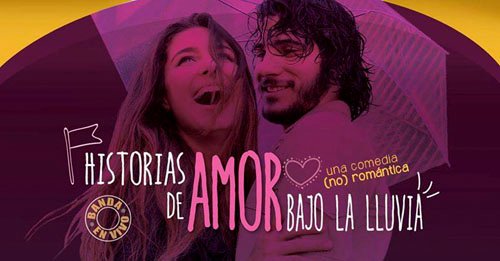Der argentinisch-deutsche Schriftsteller und Dichter Roberto Schopflocher wurde in der Botschaft der Bundesrepublik Deutschand in Buenos Aires mit dem Bundesverdienstkreuz am Bande ausgezeichnet
 Am 30. April ist der argentinisch-deutsche Schriftsteller und Dichter Roberto Schopflocher in der Botschaft der Bundesrepublik Deutschand in Buenos Aires mit dem Bundesverdienstkreuz am Bande ausgezeichnet worden. Mit der Ehrung würdigte Bundespräsident Joachim Gauck die großen Verdienste Schopflochers um die argentinisch-deutschen Beziehungen, besonders im kulturellen und literarischen Bereich. Botschafter Bernhard Graf von Waldersee nahm die Ehrung vor. Roberto Schopflocher begleiteten seine Frau, Kinder, Enkel und enge Freunde.
Am 30. April ist der argentinisch-deutsche Schriftsteller und Dichter Roberto Schopflocher in der Botschaft der Bundesrepublik Deutschand in Buenos Aires mit dem Bundesverdienstkreuz am Bande ausgezeichnet worden. Mit der Ehrung würdigte Bundespräsident Joachim Gauck die großen Verdienste Schopflochers um die argentinisch-deutschen Beziehungen, besonders im kulturellen und literarischen Bereich. Botschafter Bernhard Graf von Waldersee nahm die Ehrung vor. Roberto Schopflocher begleiteten seine Frau, Kinder, Enkel und enge Freunde.
Durch sein Schreiben in Spanisch und seit vielen Jahren hauptsächlich in Deutsch baute und baut Roberto Schopflocher, der 1923 in Fürth geboren wurde, 1937 mit seiner Familie vor den Nationalsozialisten fliehen musste und in Argentinien eine neue Heimat fand. eine Brücke des Verständnisses zwischen beiden Kulturen.
In seiner Rede sagte der Botschafter: “In Ihrer Kindheit und Jugend in Deutschland mussten Sie die Diskriminierung und den Rassenhass der Nationalsozialisten aus eigener Hand erfahren. Im April 1937 gelang Ihrer Familie die Flucht nach Argentinien, wo Sie sich nach einem Ausflug in die Landwirtschaft in Córdoba schließlich in Buenos Aires niederließen und im väterlichen Chemiebetrieb tätig waren. Erste erfolgreiche Veröffentlichungen – von landwirtschaftlichen Fachbüchern – ließen aber bereits damals erahnen, dass Ihre wahre Leidenschaft in einem ganz anderen Bereich zu finden war. 1980 wandten Sie sich dann ganz dem Schreiben zu, ihrer “wirklichen Berufung”, wie Sie einmal sagten. Sie veröffentlichten zunächst in spanischer Sprache. Neben vielen anderen Ehrungen wurde Ihnen dafür als erstem nicht in Argentinien geborenen Autor der Dritte Literaturpreis der Stadt Buenos Aires verliehen.
1995 begannen Sie, auch auf Deutsch zu schreiben und zu veröffentlichen. Das wird ein wichtiger Schritt für Sie gewesen sein. Mit “Erzählungen aus Argentinien” brachten Sie dem Publikum in Deutschland die ganze Vielfalt dieses wunderschönen Landes näher. “Wahlheimat und Heimatwahl” wirft schon im Titel die Frage nach der Heimat der Emigranten auf – eine Frage, deren Aufarbeitung Sie sich immer wieder gewidmet haben.
Christian Schmidt, heute deutscher Bundesminister für Ernährung und Landwirtschaft, hat einmal in Ihrer Heimatstadt Fürth in einem Grußwort für Sie sehr schön ausgedrückt, dass Sie nach seinem Eindruck “gleich mehrere Heimaten erlebt” haben.
Als Vertreter Deutschlands in Argentinien betrifft mich vor allem: Ihrer deutschen Heimat beraubt, haben Sie sie doch nie aufgegeben.
Auch Ihr deutschsprachiges Werk wurde ausgezeichnet, als Ihnen 2008 von Fürth der Jakob-Wassermann-Literaturpreis verliehen wurde. Bei Ihrer Laudatio hat Professor Och damals herausgearbeitet, wie Sie – in einer Reihe mit anderen großen Emigranten – sich dem Erbe der Aufklärung verpflichtet fühlen. Ihre 2010 erschienenen “Lebenserinnerungen” heißen “Weit von wo. Leben zwischen drei Welten”. Haben Sie wirklich “zwischen” den Welten gelebt? Oder auch vielleicht eher “in” ihnen: als Deutscher, Jude und Argentinier? Auf jeden Fall aber haben Sie durch Ihr Leben und Ihre Erzählungen und Romane es erreicht, Deutschland, Argentinien und jüdischen Glauben, jüdische Identität auf ganz besondere Weise zu verbinden. Und aus diesem Blickwinkel vergleichen, untersuchen und bewerten Sie, stets uneitel und immer der Toleranz der Gerechtigkeit verpflichtet. “Wir wollen den Fluch in Segen verwandeln” – dieses Wort aus der von Ihnen mit herausgegebenen Autobiographie von drei Generationen der jüdischen Familie Neumeyer haben Sie nicht zufällig zum Titel dieses Buches gemacht.
Lieber Herr Schopflocher: mit Ihrem literarischen Werk, mit Ihrem Lebenswerk und zugleich in Ihrem aktiven und bis heute unermüdlichen Einsatz für die Vermittlung und das Verständnis deutscher Sprache und Kultur, vor allem hier in Argentinien, haben Sie in überzeugender Weise das Ansehen und den Ruf Deutschlands gemehrt und sich besondere Verdienste um die Bundesrepublik Deutschland erworben. Daher hat Sie Bundespräsident Joachim Gauck mit dem Bundesverdienstkreuz am Bande ausgezeichnet. Ich habe heute die große Freude und Ehre, diese Auszeichnung im Namen des Herrn Bundespräsidenten zu überreichen und möchte Ihnen dazu erneut sehr herzlich gratulieren.”
Roberto Schopflocher bedankte sich mit den Worten: “Diese hohe Auszeichnung ruft nicht zuletzt die Hoffung in mir wach, dass ich nicht ganz umsonst auf dieser Welt wandelte, sondern meinen bescheidenen Beitrag geleistet habe, um diese ein klein wenig besser zu verstehen.
Ich empfinde mich als ein Glied der Generationenkette, die die Vergangenheit mit der Zukunft verbindet. Gleichzeitig erfüllt mich das Bewusstsein, dass es nicht nur das von den Vorfahren übermittelte Erbe ist, sonderrn nicht weniger die Umwelt, die mich von Kindesbeinen an geprägt hat. Wie sollte es auch anders sein? Habe ich doch meine Urheimat, das fränkische Fürth, in der Tiefe meines Inneren trotz der noch immer unfassbaren Schrecknisse des 20. Jahrhunderts nie ganz verlassen. Und somit sehe ich mich nicht nur als einen der Zeitgenossen, die vom letzten Schimmer der kurzen Blütezeit profitierten, die das sich gegenseitig befruchtenden deutsch-jüdische Bürgertum ab dem letzten Drittel des 19. Jahrhunderts gekennzeichnet hat, wenn freilich auch auf schwankendem Untergrund. Sondern ich bin auch einer der dankbaren Zeugen, die den guten Willen der unbelasteten Nachkriegsgenerationen und den Kniefall Willy Brandts erleben durften.
Dabei kann ich allerdings meinen seelischen Zwiespalt nicht verleugnen, den ich, der ich seit 1937 in Argentinien lebe, bereits vor Jahren in folgendem Gedicht zum Ausdruck brachte, das in meinem Lyrikband “Hintergedanken” zu finden ist:
GESTÄNDNIS
Seit über sechzig Jahren
in Argentinien, aber
beim Worte ‘Baum’
fällt mir zunächst und noch immer
die Dorflinde Rannas ein,
in der Fränkischen Schweiz,
gelegentlich auch eine Eiche,
eine Kiefer oder ein Tannenbaum;
nie dagegen oder doch nur selten
ein Ombú der Pampa,
ein Paraíso in Entre Ríos
ein Ñandubay, Lapacho oder Algarrobo,
wie sich’s doch geziemen würde
schon aus Dankbarkeit
dem lebensrettenden Land gegenüber.
Aber ‘Frühling’ bedeutet mir noch immer
Mörikes blau flatterndes Band.
Schiller, Goethe und die Romantik,
Jugendstil, Bauhaus und Expressionismus,
prägten mir ihren Siegel auf,
nicht weniger wie der deutsche Wald,
der deutsche Professor
oder der jüdische Religionsunterricht –
wohlgemerkt: der der letzten Zwanziger-,
der ersten Dreißigerjahre.
Ja, selbst der fragwürdige Struwwelpeter,
Karl May, Hauff, die Grimm’schen Märchen
oder Max und Moritz, diese beiden,
rumoren weiter in mir
und lassen sich nicht ausrotten.
Nun ja: Leider! Trotz alledem.
Oder etwa Gottseidank?
Und wo liegt es nun, mein Vaterland?
Wo aber liegt mein Vaterland? Elie Wiesel zitiert den Rabbi Nachman aus Brazlaw, einen Urenkel des Mystikers und Begründer des Chassidismus Baal Schem Tow: “An irgend einem Ort lebt ein Mensch der eine Frage aufwirft, auf die es keine Antwort gibt. Eine Generation später, an einem ganz anderen Ort, lebt ein Mensch, der auch eine Frage stellt, auf die es ebenfalls keine Antwort gibt – und er weiß nicht, kann es gar nicht wissen -, dass seine Frage in Wirklichkeit eine Antwort auf die erstere darstellt.”
Gestatten Sie mir, dass ich diese Überlegung, der ich nichts hinzuzufügen habe, im Raum stehen lasse. Und nehmen Sie, sehr verehrter Herr Botschafter, und durch Sie die von Ihnen vertretene Bundesrepublik Deutschland nochmals meinen tiefempfundenen Dank für diese unerwartete Auszeichnung entgegen, deren vielfache Bedeutung mir und meiner Familie voll bewusst ist.”

Foto oben:
Roberto Schopflocher (links) und der deutsche Botschafter Bernhard Graf von Waldersee.
Foto unten:
Roberto Schopflocher im Kreise seiner Familie und mit Botschafter von Waldersee.
(Fotos: Deutsche Botschaft)

 Herzstück ist ein moderner Konzertsaal, der aufgrund seiner Form und Farbe “Ballena Azul” (Blauer Wal) genannt wird. Hier finden 1750 Zuschauer Platz. Der Raum wird dominiert von einer großen Orgel, die von der deutschen Firma Klais angefertigt wurde. In dem Saal wird das Nationale Symphonieorchester seinen Sitz haben. Ein weiterer Saal für Kammermusik mit einem Fassungsvermögen von 600 Personen befindet sich im Untergeschoss.
Herzstück ist ein moderner Konzertsaal, der aufgrund seiner Form und Farbe “Ballena Azul” (Blauer Wal) genannt wird. Hier finden 1750 Zuschauer Platz. Der Raum wird dominiert von einer großen Orgel, die von der deutschen Firma Klais angefertigt wurde. In dem Saal wird das Nationale Symphonieorchester seinen Sitz haben. Ein weiterer Saal für Kammermusik mit einem Fassungsvermögen von 600 Personen befindet sich im Untergeschoss. Dem Namensgeber ist auch ein eigener Raum gewidmet, in dem persönliche Erinnerungen an den Ex-Präsidenten sowie ein Landschaftspanorama aus Kirchners patagonischer Heimat zu sehen sind. Gekrönt wird das Gebäude von einer Glaskuppel, von der aus man einen beeindruckenden Blick über das Hafenviertel und den Río de la Plata hat.
Dem Namensgeber ist auch ein eigener Raum gewidmet, in dem persönliche Erinnerungen an den Ex-Präsidenten sowie ein Landschaftspanorama aus Kirchners patagonischer Heimat zu sehen sind. Gekrönt wird das Gebäude von einer Glaskuppel, von der aus man einen beeindruckenden Blick über das Hafenviertel und den Río de la Plata hat.