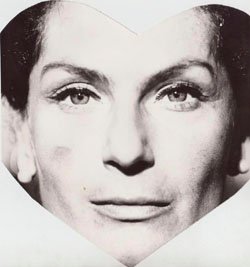“Als ich mit dem Papst U-Bahn fuhr”
Auszüge aus dem Leben von Franziskus – die Geschichte eines Menschen
Von Michaela Ehammer

Es gibt viele Dinge, die wir über unseren Papst Franziskus wissen: Er kommt aus Argentinien und ist stolz darauf, ist ein großer Fußballfan, stets hilfsbereit, trinkt gerne Mate und stellt den Vatikan gehörig auf den Kopf. Nach seiner Amtseinführung am 19. März 2013 haben sich viele Dinge in und um den Vatikan verändert: Montags gibt es einen kostenlosen Haarschnitt für Obdachlose, das elegante Hotel wurde durch eine beschauliche Pension ausgetauscht, teure Kleider lehnte er von Anbeginn ab. Jorge Mario Bergoglio sorgt mit seiner unkonventionellen Art und mit seinen teils drastisch formulierten Sprüchen (“Die Kurie hat spirituellen Alzheimer”) für so viele Schlagzeilen, dass der Blick auf seine Wurzeln selten geworden ist. Doch wer ist dieser Mann? Und wie lebte er davor?
Die Vergangenheit des Argentiniers ist bunt, komplex und voller Brüche. 1998 war er Erzbischof, 2001 Kardinal. Er stand auf dem Abstellgleis und wollte seine berufliche Karriere ändern. Schriftstellerin Erika Rosenberg geht ihm in ihrem aktuellen Buch, der Biographie “Als ich mit dem Papst U-Bahn fuhr – Jorge Bergoglio aus Buenos Aires”, auf den Grund, schreibt über ihn als Menschen und berichtet von einer Seite, die den meisten von uns bisher wohl unbekannt blieb: Über das Verliebtsein des jungen Jorge, die Auswanderung seiner Familie von Italien nach Argentinien, über die Schatten- und Sonnenseiten seiner geistlichen Karriere, und gibt uns somit einzigartige Einblicke in das Leben jenes Mannes, der heute als Papst viele auf der ganzen Welt prägt.
Er sei anders, etwas Besonderes, könne vieles bewirken und sei “ein Papst zum Anfassen”, so die Autorin. Im Buch wird beschrieben, dass er Rosenkränze von Prostituierten segnete. Isabella, eine davon, kann sich noch gut an ihre Begegnung mit “Pater Jorge” erinnern. Sie habe ihn um einen Rosenkranz gebeten mit den Worten: “Vater, ich lebe in Sünde” – seine Antwort war simpel: “Wir sind alle in Sünde”. Und genau diese Aussagen seien es, die aus dem Geistlichen einen Menschen machen, so Rosenberg.
Doch wie kommt es zum Buch? Alles fing 1997, bei einer Gedenktafel für die Opfer des Holocausts in der Kathedrale von La Plata an. Fasziniert von seinen Worten schrieb Erika Rosenberg heimlich in der Kirche mit. Danach hat sie ihn in der U-Bahn, in der Linie A getroffen. Alle wären hell angezogen gewesen, nur Pater Jorge war in Schwarz gekleidet und seine Präsenz fiel auf. So drängte sich die Jüdin hin und fragte, ob es eine Annäherung zwischen Katholiken und Juden gäbe. Seine Antwort war einfach und verblüffend zugleich: “Ein guter Christ ist kein Antisemit!” Wieder blieb er ihr im Gedächtnis. Als sie ihn dann noch einmal in der U-Bahn getroffen hat und er dann schließlich zum Papst gewählt wurde, kam der Entschluss, ihm ein Buch zu widmen. Am 27. August 2014 war sie bei einer Audienz und er meinte: “Jetzt haben Sie alles für das Buch. Ich glaube, jetzt sind Sie damit fertig.” Wird er wohl wissen, denn auch der Papst höchstpersönlich hat mit dem Rabbiner Abraham Skorka ein Buch geschrieben, welches den Titel “Über Himmel und Erde” trägt.
Bücher vom Papst gibt es mittlerweile schon viele, warum ist also genau dieses Buch so besonders? Rosenberg hat für diese Biographie lange und äußerst genau recherchiert, sich mit Leuten aus seinem früheren Umfeld, etwa seinen Nichten, unterhalten, Informationen von einem Gefangenen sowie von anderen Priestern, die ihn persönlich kannten, gesammelt und dem Papst höchstpersönlich von diesem Buch berichtet. Es beruft sich somit auf Erinnerungen von Familienmitgliedern und engen Weggefährten und gibt einzigartige Einblicke in das wahre Leben Jorge Mario Bergoglios.
Erika Rosenbergs Buch “Als ich mit dem Papst U-Bahn fuhr – Jorge Bergoglio aus Buenos Aires”, unter der Mitarbeit von Ulrike Nikel, ist am 23. Februar 2015 beim HERBIG Verlag auf Deutsch erschienen (236 Seiten mit 23 Fotos).
Lesungstermine in Deutschland im April: 7.4. (Detmold, Augustinum); 8.4., 19 Uhr (92676 Speinshart, Kloster, Klosterhof 2); 9.4., 19 Uhr (07546 Gera, Katholische Pfarrei, Kleiststr. 7); 13.4., 19.30 Uhr (73033 Göppingen, Katholische Erwachsenenbildung, Zeigelstr. 14); 20.4. (97631 Würzburg, Haus St. Michael – Mehrgenerationenhaus, Familienbildungs- und Begegnungshaus der Diözese, Wallstr. 49); 21.4., 19.30 Uhr (85049 Ingolstadt, Katholische Erwachsenenbildung, Hieronymusgasse 3).
Infos auf Erika Rosenbergs Webseite.
Foto:
Erika Rosenberg mit ihrem Buch über den Papst.
(Foto: Michaela Ehammer)